Q-Fieber: Gefahr für Mensch und Tier
Q-Fieber ist eine durch das Bakterium Coxiella burnetti verursachte Erkrankung mit weltweiter Verbreitung. Betroffen ist ein weites Spektrum an Wirtstieren, im Besonderen Schafe, Ziegen und Rinder. Da auch Menschen erkranken können, handelt es sich um eine Zoonose. Neueste Ergebnisse einer Studie der Veterinärmedizinischen Universität Wien zeigen, dass mehr als 50% der Rinderbetriebe Coxiella-Antikörper in der Tankmilch enthalten und damit Kontakt zum Erreger hatten (Lambacher et al 2024).
Übertragung
Eine Einschleppung des Erregers in die Herde kann besonders durch Zukauf infizierter Tiere oder durch benachbarte Herden erfolgen. Die Übertragung beim Decken ist ebenso denkbar. In der Praxis lässt sich der Ursprung einer Infektion häufig nicht mehr sicher nachvollziehen. Übertragen wird das Bakterium hauptsächlich über erregerhältige Stäube oder Tröpfchen bei direktem Kontakt zu infizierten Tieren sowie deren Ausscheidungsprodukten. Auch wenn sich eine infizierte Tierherde mehrere Kilometer entfernt befindet, kann es noch zu Infektionen kommen, wenn erregerhaltiger Staub über die Luft verbreitet wird. Eine größere Menge des infektiösen Erregers wird mit Geburtsflüssigkeiten und Nachgeburten von infizierten Wiederkäuern ausgeschieden. Auch bei der Schlachtung von Wiederkäuern kann der Erreger übertragen werden. Beim Verzehr von ausreichend durchgegartem Fleisch besteht jedoch kein Übertragungsrisiko. Das Risiko einer Ansteckung durch das Trinken von Rohmilch und den Verzehr von Rohmilchprodukten wird als niedrig eingeschätzt, ist aber prinzipiell möglich. Pasteurisieren führt zu einer Inaktivierung des Erregers. Die Übertragung durch Zecken ist noch nicht eindeutig geklärt. Jedoch dürfte vor allem der Zeckenkot eine wesentliche Rolle bei der Verbreitung von C. burnetii spielen, da infizierte Zecken große Erregermengen mit dem Kot ausscheiden.
Symptome
Je nach Infektionsdosis zeigen sich klinische Symptome erst 2 – 3 Wochen nach der Infektion. Die Symptome können ganz unterschiedlich ausgeprägt sein. Besonders bei Schafen und Rindern kann eine Infektion mit Coxiella burnetii ohne klinische Anzeichen einer Erkrankung verlaufen. Im Gegensatz dazu kommt es bei Ziegen häufig zum Abort (Fehlgeburt). Generell können Fehlgeburten, Totgeburten, Geburt lebensschwacher Tiere und verzögerter Abgang der Nachgeburt mit einer C. burnetii-Infektion bei Wiederkäuern in Verbindung gebracht werden.
Nachweis einer Infektion
Der aussagekräftigste Test zum Nachweis einer Coxiella burnetii-Infektion ist die molekular-biologische Untersuchung (PCR) von Nachgeburtsmaterial und toten Lämmern bzw. Kälbern zum Nachweis des Genmaterials (DNS) des Erregers. Wird der Abort nicht zur Gänze eingesandt, empfiehlt sich zumindest die Einsendung der Brustorgane, Leber, Milz, Niere, Labmageninhalt und Gehirn. Mit der PCR-Untersuchung kann eine aktuelle Ausscheidung von Coxiella burnetii nachgewiesen werden. Im Rahmen des TGD Programms „Abortuntersuchung“ werden die Kosten für Probenahme, Einsendung und Laboruntersuchung vom TGD übernommen. Dem Landwirt bzw. Tierarzt entstehen keine Kosten.
Eine Blutuntersuchung auf Coxiellen-Antikörper zeigt eine zurückliegende Infektion und kann zur Ursache eines akuten Krankheitsgeschehens nur wenig Information liefern.
Behandlung und Bekämpfung
Die Behandlung von Tieren mit dem Ziel die Erreger-Ausscheidung entscheidend zu reduzieren oder gar zu unterbinden, ist nach aktuellem Wissensstand nicht möglich. Allerdings reduziert eine Impfung gegen C. burnetii langfristig die Ausscheidung des Erregers bei infizierten Tieren. Hierzu müssen alle weiblichen Rinder des Betriebes zweimalig grundimmunisiert und einer jährlichen Auffrischungsimpfung unterzogen werden.
Q-Fieber beim Menschen
Menschen infizieren sich meist über kontaminierten Staub oder durch direkten Kontakt zu infizierten Tieren, deren Körpersekreten, Nachgeburten und Geburtsflüssigkeiten.
Bei ungefähr 40% der infizierten Personen tritt die akute Verlaufsform auf. Häufig beobachtete Symptome sind Fieber, Gliederschmerzen, starker Frontalkopfschmerz (hinter den Augen) und Mattigkeit. Aufgrund der unspezifischen Symptome kann diese Form leicht mit einem grippalen Infekt verwechselt werden. Bei ca. 10 % der Fälle tritt eine atypische Pneumonie (Lungenentzündung) und/oder granulomatöse Hepatitis (Leberentzündung) auf. Sehr selten führt die Infektion zu einer Myokarditis (Herzmuskelentzündung), Perikarditis (Herzbeutelentzündung) oder Meningoenzephalitis (Gehirnhautentzündung). Wichtig: Bei klinischem Verdacht auf eine Endokarditis (u.a. Herzklappenveränderungen, subfebrile Temperatur) sollte immer eine Abklärung auf das Vorliegen eines chronischen Q-Fiebers durch den behandelnden Arzt erfolgen.
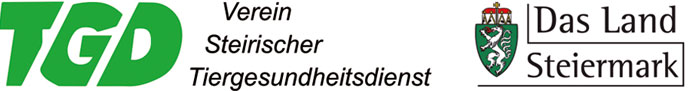

 Dr. Möser
Dr. Möser


















